Anhang
Aus dem Zettelkasten der Zeit
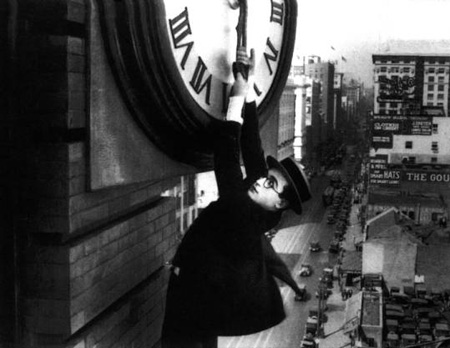
Harold Lloyd – Ausgerechnet Wolkenkratzer (USA 1923)
http://www.haroldlloyd.com
Inhalt
Anhang A. Zeitbegriffe
Anhang B. Ökonomie der Zeit
Anhang C. Chronophotographie
Anhang D. Medien im Tagesablauf in Deutschland
Anhang E. Das Möbiusband der Medien-Zeit
Anhang A. Zeitbegriffe
Absolute Zeit
Newtons Prinzip der linearen, metrischen und messbaren Zeit, die nach
einem ‚Uhrwerk’ im Universum abläuft.
Abstrakte Zeit
Messbare Zeit in institutionalisierten Einheiten der Uhrzeit oder der
Kalenderzeit angegeben. (Auch ‚objektive Zeit’, ‚reale Zeit’, ‚physikalische
Zeit’ oder ‚temps’)
Analytische Zeit
Ökonomisches Zeitkonzept als umkehrbare Einheit eines Modells. Objektive
Dauer der Zeit-Einheiten werden als exogene wirtschaftliche Faktoren angenommen.
Zukunft und Vergangenheit spielen für eine ökonomische Entscheidung keine
Rolle. (Auch ‚operational time’, ‚logische Zeit’, ‚t-Zeit’ oder ‚Modellzeit’)
Chronobiologie
Zeitwissenschaft, die Lebewesen – von Einzellern bis zu Menschen – nach
biologischen Zeiten - ‚inneren’ Uhren untersucht.
Chronometer
1714 geprägte Bezeichnung für Schifffahrtsuhren zur Bestimmung des Längengrades
auf See. Heute allgemeine Bezeichnung für Zeitmesser.
Chronometrie
Zeitmessung
Chronometrische Zeit
Zeit die in abstrakter Uhrzeit messbar ist.
Chronophotographie
Reihenfotografie zur Darstellung von Bewegungsabläufen.
Chronos <gr. Kronos>
Griechischer Gott der Ernte und der Zeit.
Chronotop
Das Lebensumfeld des Menschen, welches sich aus zeitlichen Strukturen
zusammensetzt. (z.B. Arbeitszeit, Erlebniszeit, Freizeit, Erholung, Zeitdruck,
Muße, Termine etc.)
Dromologie
Lehre von der Beschleunigung der Gesellschaft. ‚Dromokratie’ bedeutet
die Herrschaft der Geschwindigkeit.
Ephemeridien / ephemere Medien
Medien deren Inhalte flüchtig sind und/oder nur kurze Zeit an einem Ort
vorkommen.
Als Ephemeriden wurden früher periodisch veröffentlichte Schriften gezählt.
Bevor zuverlässige Uhren technisch möglich waren wurden Ephemeriden in
Form von Tabellen in denen die täglich wechselnden Konstellationen von
Sonne, Mond und Planeten zueinander verzeichnet waren, eingesetzt, um
die Zeit astronomisch zu bestimmen.
Filmzeit
Spezielle Zeitlichkeit eines Films, welcher über seine Montage Zeitlichkeiten
vermittelt, die sich nicht mit der in der Wirklichkeit vorfindlichen Zeitabläufen
decken und von jedem Individuum anders wahrgenommen werden können. (Auch
‚filmische Zeit’ oder ,Zeit-Bild’)
Güterzeit
Ökonomisches Zeitkonzept, um Zeit als ein knappes Gut zu modellieren
und ihre optimale Allokation auf konkurrierende Verwendungszwecke hin
zu analysieren.
Individualzeit
Unbegrenztes Spektrum der Möglichkeiten eines Individuum Zeit wahrzunehmen
und zu gestalten. Subjektives und psychisches, nichtmetrisches Zeiterleben
des Individuums. (Auch ‚subjektive Zeit’, ‚psychische Zeit’, ‚Eigenzeit’,
‚Durée’)
Kategoriale Zeit
Durch Medien (z.B. der Uhr) vermittelte Zeit, welche zur Ausbildung sozialer
Institutionen (z.B. der Uhrzeit) führt. Kategoriale Zeit ist die menschengemachte
Zeit, nach der sich Gesellschaften orientieren. Kategoriale Zeit ist demnach
das erlernbare Konstrukt, mit dem Menschen die vorkategoriale Zeit erfassen.
Medien-Zeit
Die Gesamtheit der unterschiedlichen Zeitlichkeiten, die aus den medialen
Schichten des Gerätes, des Dispositivs und der symbolischen Form hervorgehen.
Muße-Zeit
Freizeit nicht als Gegensatz zur Arbeitszeit, sondern als Zeit die in
Abkopplung von den gesellschaftlichen Zeitmustern verbracht wird.
Ökonomische Zeit
Sammelbegriff für die Zeitkonzepte der Ökonomie: Analytische Zeit, Perspektivische
Zeit und Güterzeit.
Perspektivische Zeit
Ökonomische Handlungsdimension von Wirtschaftakteuren. Akteure haben eine
individuelle Vorstellung von Zeit und verorten sich dementsprechend in
Relation zur Vergangenheit, Gegenwart und einer unsicheren Zukunft.
Prime Time
Zuschauerstärkste Ausstrahlungszeit (z.B. 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen)
Raumzeit
Der vierdimensionale Raum, dessen Punkte Ereignisse sind.
Relative Zeit
Jedes Individuum hat in Abhängigkeit seines Standortes und seiner Bewegung
sein eigenes Zeitmaß. Zeit wird nicht von der ‚Uhr des Universums’ vorgegeben
(absoulute Zeit), sondern existiert nur in Relation zu anderen Zeitgebern.
Vorategoriale Zeit
Zyklische, unumkehrbare und unteilbare Zeit des Universums. Der Wechsel
der zyklischen Jahreszeiten und Tagesrhythmen gehört ebenso dazu, wie
die biologische Zeit jedes Lebewesens. Auch ‚Universalzeit’ oder ‚historische
Zeit’.
Zeit – der Begriff
Die Wortwurzeln des althochdeutschen (zit), des germanischen (ti-di),
des altindischen (dati) und altnordischen (tina) bedeuten ‚zerteilen’,
‚zerschneiden’, ‚zerpflügen’. Der Begriff der Zeit bezieht sich demnach
bereits auf eine kategoriale Zeitwahrnehmung.
Zeit – das Konzept
Die Gesamtheit ihres vorkategorialen Seins (u.a. zyklische Wiederkehr
von Tag und Nacht), ihrer kategorialen Struktur (u.a. Uhrzeit, Kalender,
chronometrische Zeit) und der menschlichen, individuellen Wahrnehmung
der Welt.
Zeitallokation
Die optimale Aufteilung des Zeitbudgets auf alternative Verwendungszwecke.
Zeitbudget
Die dem Individuum zur Verfügung stehende Zeit. 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche, unbestimmte Lebenszeit.
Zeitinstitutionen
Vermittelte Zeitkonzepte, welche die zeitliche Organisation der Gesellschaft
ermöglichen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelten als fundamentale
Institutionen, Uhrzeit, Weltzeit, Kalenderzeit, Arbeitszeit etc. als abgeleitete.
Zeitpfeil (auch Zeitstrahl)
Die ‚Richtung’ in welcher die Zeit verläuft; ökonomische Abbildung, zur
Abtragung von ökonomischen Zeiteinheiten.
Zeitrestriktion (time constrains)
Begrenzungen des Zeitbudgets. Analog zu monetären Budgetristriktionen
oder Informationsrestriktionen.
Anhang
B. Ökonomie der Zeit
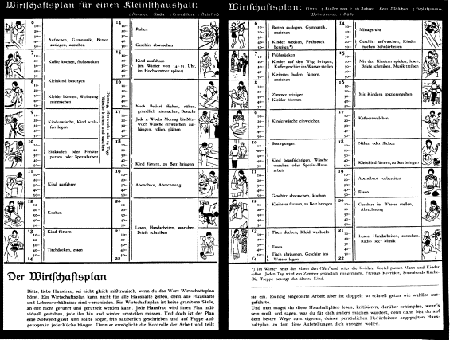
Der Wirtschaftsplan der Hausfrau
Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993): S. 328/329
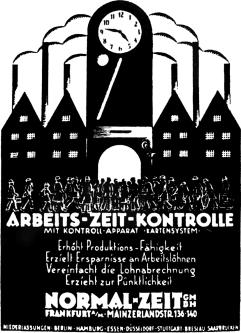
Anzeige der Normal-Zeit GmbH, 1923
Dohrn-von Rossum, Gerhard (1992): S. 295
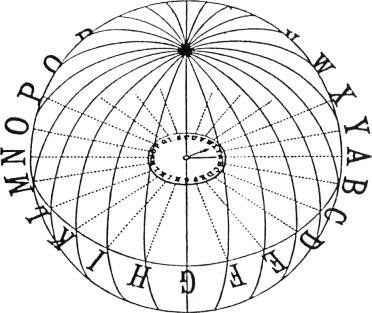
Alphabetische Aufteilung der ‚Standard Time Divisons’
Fleming, Sanford (1876): S. 13
»London time is kept at all the stations on the railway,
which is about 4 minutes earlier than Reading time;
5 minutes before Cirencester time;
8 minutes before Chippenham time;
and 14 minutes before Bridgewater time«
Britischer Eisenbahn-Fahrplan
zitiert nach Lash, Scott / Urry, John (1994): S. 229
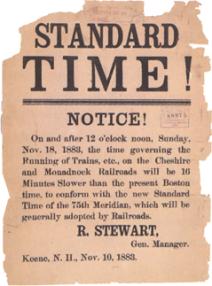
Standard Time broadsheet, 10. November 1883
Lippincott, Kirsten (1999): S. 134
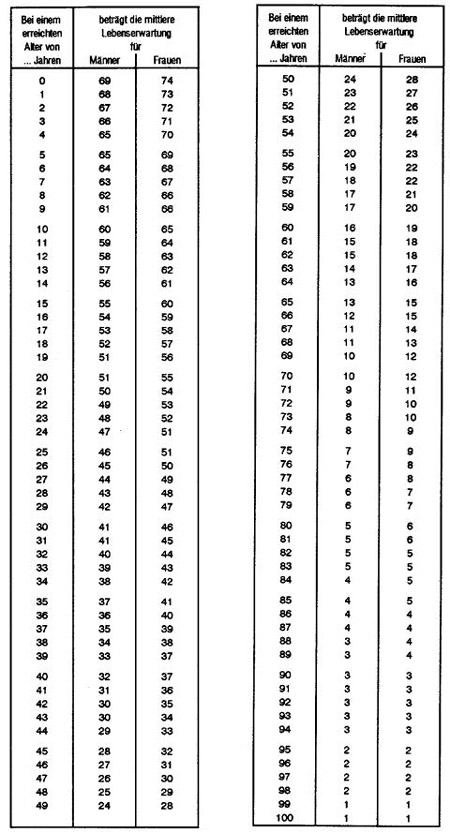
Sterbetafeln des Bundesamtes für Wirtschaft und Statistik
Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993): S. 18/19
Anhang C. Chronophotographie
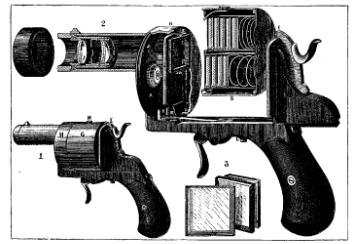
Ejalberts photographischer Revolver, Halle 1887
Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993): S. 201
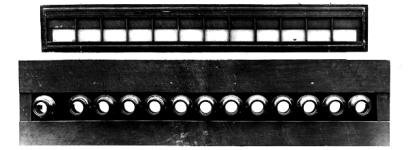
Eadweard Muybridge’s Camera, ca. 1887
Eadweard Muybridge Papers from the collections of the
University of Pennsylvania Archives and Records Center. Web exhibit November
1999. Online veröffentlicht: http://www.archives.upenn.edu/faids/upt/upt50/muybridgee.html
[Stand: Juni 2002]

Flow Motion Kameraanordnung auf dem Set
von »The Matrix«
Warner Bros. (1999): The Matrix: Presseinformation, Hamburg
Anhang D. Medien im Tagesablauf in Deutschland
Medien-Zeitbudget in Deutschland
| Kategorie |
Medium |
Zeitbudget
in Minuten |
| Kommunikationsmedien |
E-Mail (privat)
Briefe schreiben
Telefonieren (privat)
SMS |
1
2
12
2 |
| Reine Unterhaltungsmedien |
Kino
Gameboy
Videospiele
Computerspiele
Video/DVD
Bücher/Comics
CD/MC |
2
*
1
4
3
9
13 |
| Massenmedien (Unterhaltungs-/Informationsmedien) |
Fernsehen
Internet (ohne eMail)
Radio
Tageszeitung
Zeitschriften |
150
6
86
19
10 |
In Anlehnung an: IP Deutschland (2002): MiT – Medien
im Tagesablauf. S. 9
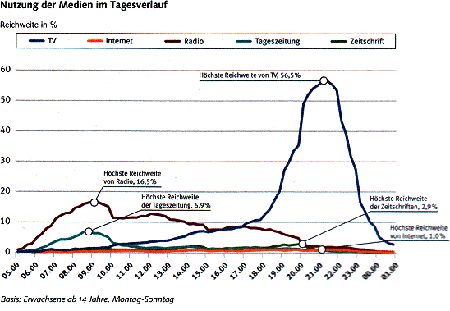
IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.
S. 36
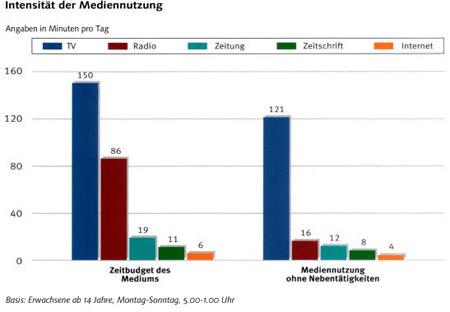
IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.
S. 44
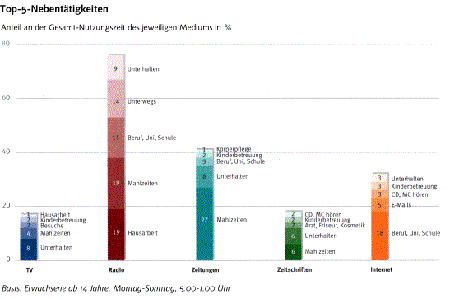
IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.
S. 44
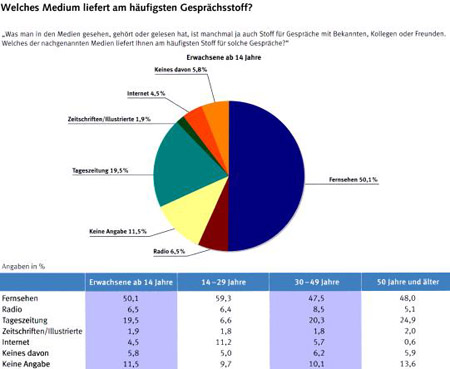
IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.
S. 31
Anhang E. Das Möbiusband der Medien-Zeit
»Nur ein zeitliches Ereignis unterscheidet Vorder- und Rückseite,
die durch die Zeit eines weiteren Rundganges getrennt sind.
Die Dichotomie der beiden Begriffe »vorn« und »hinten«
erscheint nur bei Hinzufügung einer neuen Dimension: der Zeit.«
Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993)
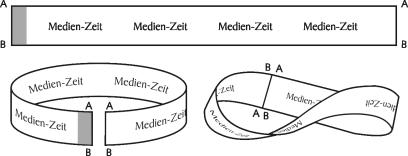
|